Afrikas Häfen warten auf Investoren

Dschibuti an der Meerenge Bab al-Mandab des Roten Meeres will Schnittstelle zu den arabischen Nachbarländern werden (Foto: Kleinort)

Dar-es-Salaam in Tansania ist einer der wichtigsten Häfen am Indischen Ozean (Foto: CCTV Africa)

Walvis Bay in Namibia wird zu einem wichtigen Universalhafen ausgebaut (Foto: Namport)
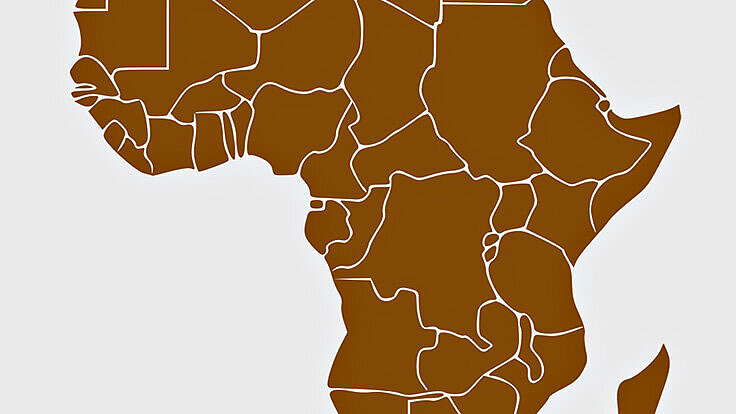

Schon heute ist Walvis Bay über eine Schienenverbindung nicht nur mit dem namibischen Hinterland, sondern auch mit den SACU-Nachbarländern verbunden (Bild: Kleinort)

Das Hafen Walvis Bay ist ein Musterbeispiel für Diversifizierung: Containerumschlag, Werften, Massengut, aber auch Fischerei und künftig sogar die Option für Kreuzfahrtanläufe bietet Namibias wichtigster Hub (Bild: Kleinort)

Analog zu Hamburg lässt sich Dschibuti schon heute als "Tor zu Ostafrika" bezeichnen. der Hafen ist zudem seit einigen Jahren Stützpunkt der internationalen Anti-Piraterie-Mission (Bild: Northsouthnews)
Die afrikanischen Staaten benötigen eine moderne und leistungsfähige Infrastruktur. Vor allem China, Japan und Indien sind bereit zu investieren. Aber auch europäische Unternehmen haben Chancen.
Schätzungsweise 1,1 Milliarden Menschen leben auf dem afrikanischen Kontinent. Bis zum Jahr 2050 dürfte sich die Bevölkerungszahl Demografen zufolge auf über zwei Milliarden Menschen verdoppeln. Für die afrikanischen Staaten eine ungeheure Herausforderung. Und für die globalisierte Wirtschaft eine ungeheure Chance. Von Produktionsmöglichkeiten über Handelszentren bis hin zu wachsenden Absatzmärkten bietet Afrika in den kommenden Jahrzehnten vielfältige Möglichkeiten.
Hierzu benötigen die afrikanischen Staaten aber Investitionen – in Schulen und Universitäten, in Energienetze und vor allem in eine leistungsfähige Infrastruktur. „Der Ausbau von Infrastruktur ist die wichtigste Voraussetzung für Fortschritt, Produktivität und nachhaltiges Wachstum auf dem afrikanischen Kontinent. Regierungen investieren derzeit Milliarden in den Ausbau ihrer Häfen, Straßen und Städte, und das Interesse an einer Zusammenarbeit mit deutschen Firmen ist groß. Dieses Momentum gilt es zu nutzen und zwar mit einer entsprechenden politischen Agenda jenseits von Entwicklungshilfe“, sagte Christoph Kannengießer, Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft, zur Eröffnung des 4. Deutsch-Afrikanischen Infrastrukturforums in Hamburg vor knapp 200 Teilnehmern.
Wenn, wie in Hamburg, über Investitionen in Hafeninfrastruktur gesprochen wird, dann ist auch automatisch die Hinterlandinfrastruktur gemeint. „Vor allem für die Binnenländer sind das ganz wichtige Verkehrsachsen, die natürlich nicht nur für die Hafenanbindung wichtig sind“, sagte Henry Bagiire Aggrey, ugandischer Minister für Staatliche Infrastruktur und Verkehr. Allein Uganda hat seine Investitionen in den vergangenen Jahren nahezu verdoppelt. Das gehe vor allem mit Public-Private-Partnerships und ausländischen Geldgebern.
Deutsche Wirtschaft zu zögerlich
Die deutsche Wirtschaft hat den afrikanischen Kontinent lange Zeit sträflich vernachlässigt und muss nun die Versäumnisse der Vergangenheit nachholen, so der Afrika-Vereins-CEO Kannengießer weiter. Die Erfolge einzelner Unternehmen könnten das fehlende Engagement eines Großteils der deutschen Wirtschaft nicht ausgleichen, die den afrikanischen Markt noch immer ignoriere.
China liegt vorne
Ganz anders China: Allein für die Jahre 2016 bis 2018 investiert die Volksrepublik über ihre staatlichen Hafen- und Infrastrukturholdings rund 56 Milliarden Euro. Die Mittel sollen die drei größten Kapazitätsengpässe des Kontinents beheben, sagte Präsident Xi Jinping im vergangenen Jahr während des Forums für China-Afrika-Kooperation in Johannesburg. Dies seien eine unzureichende Infrastruktur sowie der Mangel an ausgebildeten Arbeitskräften und Finanzmitteln in bestimmten Ländern des Kontinents. Im Zentrum stehen der Bahnsektor, das Straßenwesen, Luftfahrt, Häfen, die Strombranche und Telekommunikation. „China wird chinesische Unternehmen ermutigen, in Afrika zu investieren.“
Japan und Indien ziehen mit entsprechenden Investitionen nach. Und die afrikanischen Staaten sind darüber nicht unglücklich, denn – losgelöst von den Bürden des Kolonialismus – fließen asiatische Fördergelder in Wirtschaftsregionen, nicht in einzelne Staaten. Auf diese Weise werden Straßen- und Schienenprojekte, medizinische Stationen, Energieversorgung und Bildungseinrichtungen projektiert, die vielen Menschen zugute kommen und nachhaltig wirken.
Kontinentale Verkehrsachsen
Beispiel „Transkontinentale Transversalen“: Bereits jetzt gibt es ein System mehr oder minder gut ausgebauter Straßenverbindungen, die Afrika von Nord nach Süd und von West nach Ost durchziehen. Aber von der Qualität beispielsweise der Transeuropäischen Netze (TEN) sind sie meilenweit entfernt. Minister Aggrey führt in diesem Zusammenhang nicht nur den Ausbau von Straßenverbindungen an. Der Viktoriasee, an dessen Ufern Tansania, Uganda und Kenia liegen, soll in den kommenden Jahren zu einem Binnenschifffahrts-Hub werden, und dabei beispielsweise über Freihandelszonen auch Ruanda, Burundi und dem Kongo nutzen. Darüber hinaus soll die insgesamt unterentwickelte Binnenschifffahrt als nachhaltige Anbindung an die ostafrikanischen Häfen entwickelt werden.
Neues Selbstbewusstsein
Durch die Förderung regionaler Wirtschaftsräume entwickle sich auch eine Art regionales Bewusstsein, und das stärke wiederum das Selbstbewusstsein der Menschen und Regierungen, sagte Aime Muzola vom ruandischen Ministerium für Infrastruktur und Maritimes. Dass der Binnenstaat Ruanda nun auch eine ministerielle Zuständigkeit für die maritime Wirtschaft hat, ist bezeichnend. Vor allem China baut nicht nur bestehende Häfen aus und entwickelt mit den Küstenstaaten neue Häfen, auch für die notwendigen Hinterlandanbindungen fließen entsprechende Fördergelder.
Zwei Projekte wurden von den Teilnehmern des Infrastrukturforums in Hamburg immer wieder genannt: Eine Nord-Süd-Verbindung von Kairo und Port Said zu den Häfen in Südafrika mit dem Aufbau mehrerer Logistik-Hubs entlang dieser Route und dem Bau eines großen Binnenhafens am Viktoriasee. Und eine West-Ost-Verbindung von Dschibuti, der Schnittstelle zwischen Ostafrika und dem arabischen Raum, zu den großen Häfen an der Westküste des Kontinents.
„An Europa vorbei“
„Es vollzieht sich eine strategische Veränderung in der Welt“, sagte Christian Eddy Avellin, Generaldirektor der Hafenverwaltung von Toamasina auf Madagaskar. „China, Indien und Japan werden immer wichtiger. Auf die Spitze getrieben könnte man sagen: ‚Europa ist out‘.“ Avellin relativierte dies gleich im Anschluss, verwies aber, wie viele andere Tagungsteilnehmer, auf Handelsrouten, die China „an Europa vorbei“ entwickle: Von Asien über Afrika nach Südamerika. Auch nach Auffassung vieler Ökonomen werde sich zwischen diesen Kontinenten im 21. Jahrhundert eine vollkommen neue Handelszusammenarbeit und ein Austausch von Know-how entwickeln.
Und auch wenn viele Afrikaner von Europa enttäuscht sind, die Verbindungen will man nicht kappen. „Wir diskriminieren niemanden und wollen uns natürlich auch mit Europa zusammen entwickeln“, sagte Namibias Botschafter in Deutschland, Andreas Guibeb. Gerade deutsche Kompetenz bei Hafen- und Hinterlandanbindungen sei sehr gefragt.
In vielen Ländern gelte auch der Grundsatz „China does much, Europe does better“. Da viele Länder wie beispielsweise Uganda auf PPPs setzen, seien deutsche Unternehmen eingeladen, sich mit ihrer Erfahrung an lohnenden Projekten zu beteiligen. Und Joseph Lunanga Busanya, Ingenieur aus der Demokratischen Republik Kongo, brachte es auf den Punkt: „Europäer beklagen immer, sie würden für die großen und lohnenden Projekte in Afrika nicht eingeladen und die Chinesen bekommen dann den Zuschlag. Ich kann nur sagen: Kommt und helft mit. Die Projekte sind da. Man muss nur anpacken.“
Zugang für andere Länder
Gerade Namibia ist bei der Wirtschafts- und Infrastrukturentwicklung vorbildlich. So ist bei der mittelfristigen Entwicklung des wichtigsten Hafens in Walvis Bay zwar auch die chinesische Hafenentwicklungsholding China Harbour Engineering Company (CHEC) quasi im Boot, aber die namibische Regierung hat sehr frühzeitig auch andere Unternehmen mit einer notwendigen Expertise eingeladen, sich am Ausbau zu beteiligen. Zudem ist Walvis Bay mittlerweile auch als ein panafrikanisches Projekt der Subsahara-Region angelegt, über das die Länder der Zollunion SACU und der Entwicklungsgemeinschaft SADC Zugang zum Südatlantik haben werden. In diesem Zusammenhang ist auch der Ausbau bestehender Straßen und Schienenverbindungen nach Botswana und Sambia begonnen worden. Einerseits wollen die Subsahara-Länder damit wirtschaftlich und logistisch unabhängiger vom großen Nachbarn Südafrika werden. Andererseits setzen sie aber außer auf Wettbewerb auch auf eine zukunftsgewandte und gemeinsame Entwicklung des südlichen Kontinents. pk
Zollunion. Fünf Länder arbeiten seit 2002 in der Südafrikanischen Zollunion (South African Customs Union, SACU) zusammen. Botswana, Lesotho, Namibia, Südafrika und Swasiland sind seit der Kolonialzeit wirtschaftlich sehr eng miteinander verbunden. Um den Handel und den Transport von Gütern zu vereinfachen, wurden die Zollbestimmungen stark vereinfacht. Dadurch konnten die früher teilweise tagelang andauernden Zollabfertigungen erheblich beschleunigt werden. Zudem betreiben die Mitgliedstaaten eine gemeinsame Währungspolitik. So gilt in Namibia beispielsweise außer der heimischen Währung, dem Namibia-Dollar, auch der Südafrikanische Rand im Wechselkursverhältnis 1:1.
Wirtschaftsunion. Eine erheblich tiefergehende Zusammenarbeit streben 15 afrikanische Staaten in der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft (South African Development Community, SADC) an. Angola, Botswana, die Demokratische Republik Kongo, Lesotho, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambik, Namibia, die Seychellen, Sambia, Simbabwe, Südafrika, Swasiland und Tansania haben eine am Vorbild der EU orientierte wirtschaftliche und politische Integration vereinbart. Vor allem Infrastrukturprojekte werden in jüngster Zeit gemeinsam geplant und mit internationaler Hilfe umgesetzt. pk

