BSH und DWD machen jetzt „gut Wetter“

Einst ein markantes Gebäude in Hamburg: Norddeutsche Seewarte, Foto: BSH

Auch in Rostock verankert: Dienstsitz des BSH an der Warnow, Foto: Arndt

Äußerst erfolgreich: die ehemalige, 2006 außer Dienst gestellte „Gauss“ am Kirchenpauerkai in Hamburg, Foto: Arndt
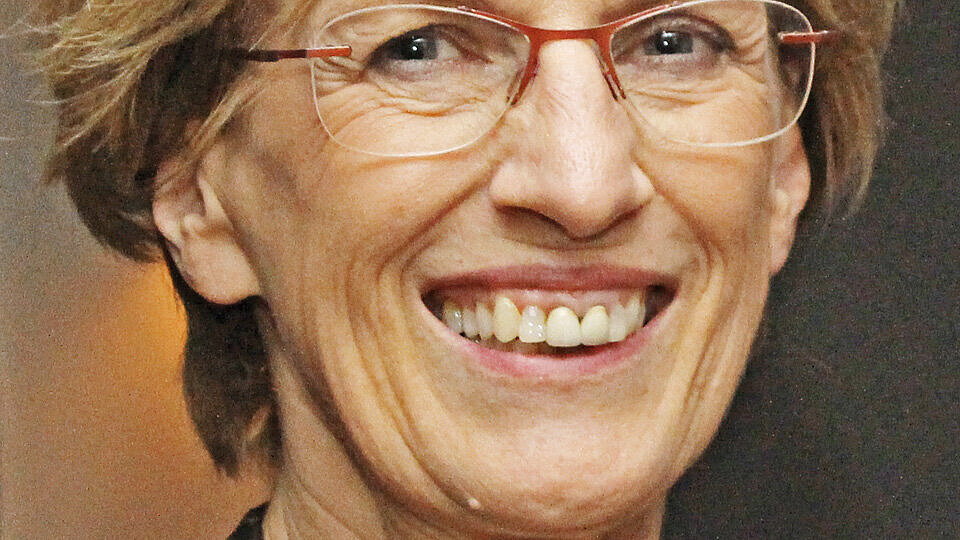
Monika Breuch-Moritz, BSH-Präsidentin, Foto: Arndt
Wetter und Seefahrt – das gehört untrennbar zusammen. Was über Jahrhunderte hinweg wohl gehütetes „Kapitänswissen“ war, wird in Deutschland seit der Mitte des 19. Jahrhunderts systematisch erforscht, dokumentiert und als unverzichtbares Arbeitswissen der Schifffahrt zur Verfügung gestellt.
Die Keimzelle für die heute wie selbstverständlich abrufbaren meteorologischen Erkenntnisse zur Wetterentwicklung rund um den Globus wurde in der Seefahrerstadt Elsfleth an der Unterweser mit der Gründung der Norddeutschen Seewarte vor 150 Jahren implantiert. Die Arbeit in dieser bahnbrechenden Einrichtung begann offiziell am 1. Januar 1868. Wilhelm Ihno Adolf von Freeden, Rektor der Großherzoglich Oldenburgischen Navigationsschule in Elsfleth, richtete in ihr die besagte Norddeutsche Seewarte ein. Das Ziel: Ozeanische Reisen sollten sicherer und kürzer für die Besatzungen der Schiffe, damals noch fast durchweg Segler, und auch für die Ladung werden.
Die spannende Entwicklung auch der deutschen „Seewetter“-Geschichte wurde am Donnerstag nicht nur mit einem besonderen Festakt im Hamburger Rathaus gewürdigt, sondern ist darüber hinaus auch im Rahmen einer Sonderausstellung für die breite Öffentlichkeit erlebbar. Das Internationale Maritime Museum Hamburg (IMMH) sowie die aus der Urzelle „Norddeutsche Seewarte“ heraus entstandenen heutigen Nachfolgeorganisationen, nämlich das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie der Deutsche Wetterdienst (DWD), erinnern gemeinsam an den Beginn der maritimen Dienste in Deutschland. Die Ausstellung, die vom 2. Juni bis 31. August im IMMH verankert ist, läuft unter dem Titel „Über Wasser – Unter Wasser“. Mit mehr als 100.000 Exponaten beherbergt das IMHH die weltweit größte maritime Privatsammlung des im Dezember 2016 verstorbenen Stifters Prof. Peter Tamm.
Heute arbeiten für das BSH an den Hauptstandorten Hamburg und Rostock rund 850 Menschen. Unter dem Dach der maritimen Behörde sind in der Land- und Bordorganisation rund 100 Berufe vereint. Sie decken die Bereiche Seeschifffahrt, Ozeanographie, nautische Hydrographie, Offshore-Windenergie und Verwaltung mit ab. Das BSH arbeitet international in mehr als 12 Organisationen und etwa 200 dort angesiedelten Gremien unter anderem bei der Entwicklung internationaler Übereinkommen mit.
In einzelnen Themenbereichen innerhalb der regulären Dauerausstellung zeigt das weit über Hamburg hinaus bekannte Museum im Herzen der HafenCity das breite Spektrum maritimer Dienste. Es reicht von Segelanweisungen und Wettervorhersagen für die Seeschifffahrt über Untersuchungen zum Laderaumklima auf Schiffen, die Vermessung der Meere, die Wracksuche, die meteorologische und ozeanographische Datenerhebung auf Schiffen über die Darstellung von Messnetzen und Sicherheit in der Seeschifffahrt bis hin zu Meeresumweltschutz und Offshore-Windenergie.
Erstmals zeigt das Museum auch Originaldokumente und -exponate aus dem Nachlass des Gründers der Norddeutschen Seewarte, Wilhelm Ihno von Freeden, und aus der Deutschen Seewarte. Und auch das gehört dazu: Erstmals seit Bestehen des BSH sind maßstabsgetreue Modelle der Flotte der maritimen Einrichtung zu besichtigen. Damit die Behörde ihre Aufgaben erfüllen kann, stehen ihr aktiv die drei Vermessungs-, Wracksuch- und Forschungsschiffe „Atair“ (in Dienst: 1987), „Deneb“ (1994), „Wega“ (1990) sowie die Vermessungsschiffe „Capella“ (2004) und „Komet“ (1998) zur Verfügung. Die Modelle ergänzen die bestehende Sammlung der Forschungs- und Vermessungsschiffe des IMMH, zu der auch Modelle des ersten deutschen Vermessungsschiffes, der „Möwe“ (1906-1914), gehören. Ein weiteres, bedeutendes deutsches Forschungsschiff ist die 1986 in Dienst gestellte „Meteor“, die allerdings nicht dem BSH zugeordnet ist, sondern zum Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gehört. Das Schiff wird dabei von der Reederei-Gruppe Briese Schiffahrt aus Leer bereedert.
In den zurückliegenden 150 Jahren wurde die Wetter- und Klimadaten-Ermittlung für die Schifffahrt und andere Bereiche systematisch weiterentwickelt. Für Monika Breuch-Moritz, BSH-Präsidentin seit Oktober 2008, ist „die Bedeutung der Meere ein großes Thema für die Klimaforschung, denn der Wärmehaushalt der Meere gibt weiteren Aufschluss über den Klimawandel“.
Auch wenn „Wetter“ und „Klima“ immer noch für Überraschungen gut sind, hat die Güte der Vorhersagen, aber auch der Datenreihen-Analyse heute ein Spitzenniveau erreicht, wobei eine Vielzahl von Datenquellen genutzt werde, unter anderem auch modernste Satellitentechnik. Zwar werden die Wetterbeobachtungen durch die Besatzungen auf See immer durchgeführt und an die zuständigen Landeinrichtungen gemeldet, doch kommen heute auch vermehrt automatische Wetterstationen zum Einsatz. Sie werden perspektivisch die „Handarbeit“ an Bord bei der Wetterermittlung ablösen. Von höchstem Wert ist auch das Wirken der sogenannten Wettersatelliten. Sie übermitteln aus dem All heraus zahlreiche Wetterdaten von den Weltmeeren.
Der DWD ist der nationale Wetterdienst der Bundesrepublik Deutschland. Seine Aufgaben sind gesetzlich geregelt. Hierzu gehören die Wettervorhersage und die Herausgabe von amtlichen Warnungen vor gefährlichen Wetterereignissen. Er ist zuständig für die meteorologische Sicherung von Luft- und Seefahrt und von wichtigen Infrastrukturen wie der Energieversorgung und Kommunikationssystemen. Zur Erfüllung seiner mannigfaltigen Aufgaben betreibt der DWD unter anderem umfangreiche Mess- und Beobachtungssysteme. Die Einrichtung vertritt die Bundesrepublik Deutschland unter anderem auch in internationalen Organisationen, wie der Weltorganisation für Meteorologie (WMO). BSH und DWD sind Bundesoberbehörden und Ressortforschungseinrichtungen, die eingebettet sind in den Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur.
Im Maritimen Museum wird neben dem Original der neuesten Schiffswetterstation auch ein Modell des zukünftigen Meteosat-Satelliten der 3. Generation gezeigt. Sein Einsatz ist für das Jahr 2021 vorgesehen. Gerade hinsichtlich meteorologischer Messtechnik fungierte die Seewarte als Vorreiter: So ist ein Nachbau des Diamant-Drachens von Wladimir Köppen zu bestaunen. Mit Drachen und Fesselballonen wurden Anfang des 20. Jahrhunderts erstmals die höheren Luftschichten untersucht. Es war damit der Beginn der sogenannten „Aerologie“, also der Höhenwetterkunde.
Die Ausstellung ermöglicht auch Einblicke in die Warndienste von BSH und DWD vor Stürmen und Sturmfluten zum Schutz der Schifffahrt und der Küstenbewohnerinnen und -bewohner. Diese Informationen gewinnen vor dem Hintergrund des globalen Klimawandels eine immer größere Relevanz.
Sicherheit in der Seeschifffahrt ist ebenfalls ein wesentliches Thema der Ausstellung. Die Entwicklung von Technologien zur Kommunikation zwischen den Schiffen und von Schiffen an Land sowie zur Navigation kann nachverfolgt werden. Dies beinhaltet auch die Darstellung des heutigen NAVTEX-Systems, mit dem Wetterwarnungen an Schiffe übermittelt werden.
Ein großes Aufgabengebiet für das BSH ist die Offshore-Windenergie. Denn der Abschied von den fossilen Brennstoffen kann nur dann gelingen, wenn in Zukunft auch große Mengen „grüne Energie“ auf See erzeugt und in die Stromnetze eingespeist werden können. In Deutschland genehmigte das BSH erstmals 2001 den Bau eines solchen Energieparks auf hoher See. Die Ausstellung zeigt neben dem Modell einer Konverterplattform und einer Offshore-Windenergieanlage unter anderem den Ausschnitt eines Blasenschleiers. Damit wird der gerade für die Meeressäuger sehr gefährliche „Rammschall“ reduziert, der bei der Installation der Fundamente für die Windkraftanlagen entsteht. Zudem werden Querschnitte von Strom- und Datenkabeln von Offshore-Windparks gezeigt, an denen deutlich wird, dass beim Thema „Energieübertragung“ in völlig neuen Dimensionen gedacht werden muss. EHA

