Die Taufe der „Helgoland“ (+ Bildergalerie)

Aufbruch: Die „Helgoland“ mit Kurs auf die gleichnamige Hochseeinsel, Fotos: Eckardt
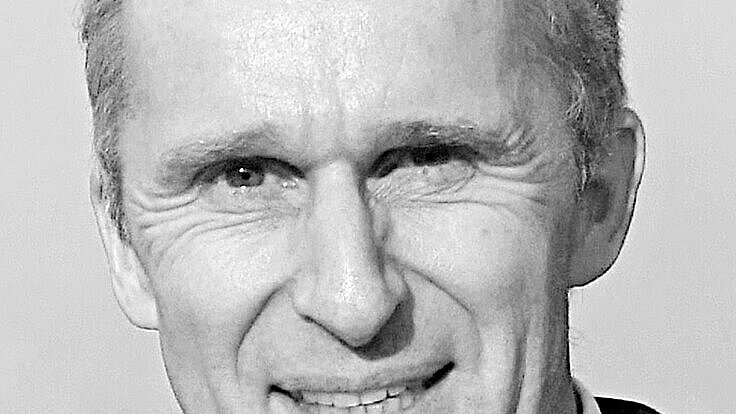
H. Fassmer, Foto: Eckardt

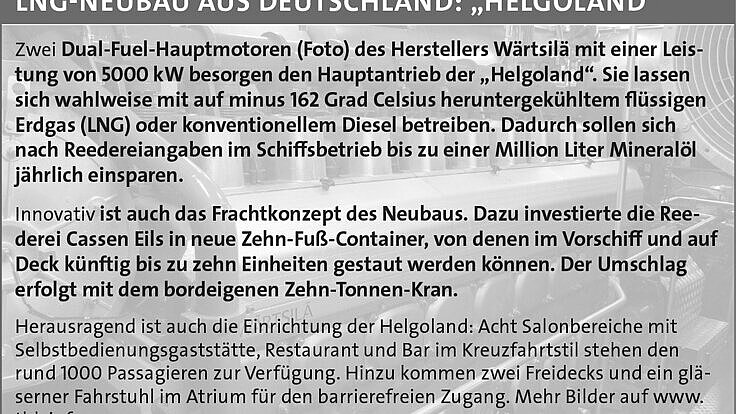
Windstärke in Böen neun, und eine Wellenhöhe bis zu vier Metern: Die „Helgoland“ hat ihre Feuertaufe auf dem Weg zum roten Felsen mit Bravour bestanden.
Zuvor wurde am vergangen Freitag am Anleger Alte Liebe in Cuxhaven deutsche Schifffahrtsgeschichte geschrieben: Christa Eils, Witwe des vor fast sechs Jahren verstorbenen Reedereigründers Cassen Eils, taufte den ersten in Deutschland erbauten und mit Flüssiggas betriebenen Schiffsneubau. Mit dabei: Über 350 geladene Gäste aus Politik und Wirtschaft.
Von morgen an wird der 83 Meter lange und 12,6 Meter breite Neubau, der von der Fassmer-Werft in Berne an der Unterweser erbaut wurde, den ganzjährigen Seebäderverkehr nach Helgoland aufnehmen. Er löst dabei das über 40 Jahre alte Seebäderschiff „Atlantis“ auf dieser Strecke ab, das zum Verkauf steht, möglicherweise aber auch verschrottet wird.
Auch wenn die Ablieferung der „Helgoland“ mehrere Monate später als geplant erfolgte – von einer möglichen Missstimmung zwischen Brons und Harald Fassmer, Geschäftsführer der Fassmer Werft, ist keine Spur. Im Gegenteil, so Bernhard Brons, Vorstand der AG „Ems“, während seiner kurzen Tauf ansprache: „Heute kann ich es Ihnen verraten, Herr Fassmer, wir waren vom ersten Tag an vom Schiff begeistert. Das ist bis heute so geblieben.“ Die Reederei Cassen Eils gehört zur rund 450 Mitarbeiter beschäftigenden AG „Ems“-Gruppe.
Nach einer ersten kleinen Proberunde auf der Elbe, auf der Kapitän Ewald Bebber die „Helgoland“ auf die maximale Geschwindigkeit von gut 20 Knoten beschleunigte, ging es auf die stürmische Jungfernfahrt zum roten Felsen.
Auch wenn sich vor allem zwischen Scharhörn und Helgoland nicht alle Gäste der Jungfernfahrt seefest zeigten: Zumindest die Fachleute waren vom Seeverhalten des Neubaus begeistert. Dazu tragen neben den optimierten Rumpfformen auch die dynamischen Stabilisatoren bei, die ein Rollen de Schiffes fast vollständig verhindern.
Der Bau der für bis zu 1040 Passagiere ausgelegten „Helgoland“ hat rund 31 Millionen Euro gekostet und wurde mit EU-Fördergeldern aufgrund des in der Schifffahrt bislang noch neuartigen LNG-Antriebskonzeptes in Höhe von fast vier Millionen Euro bezuschusst.
Reedereivorstand Brons sieht die Investition gut angelegt: „Das Schiff, das im Design den bisherigen Seebäderschiffen entspricht, haben wir für die nächsten 40 Jahre konzipiert.“
Es habe zwar ein bisschen länger gedauert mit der Indienststellung, entscheidend sei aber „der technische Quantensprung. Denn durch die LNG-Technologie werden unter anderem 90 bis 95 Prozent weniger Schwefel und Stickoxide ausgestoßen. Und Feinstaub fällt völlig weg.”
Für Harald Fassmer ist der Neubau „eine großartige Referenz in Richtung Zukunft und Umweltschutz“. Auch wenn seine Werft mit diesem Neubau aufgrund der umfangreichen Sicherheitsaspekte viel dazu lernen musste, sieht Fassmer die „Helgoland“ auch als Leuchtturmprojekt und Türöffner für weitere Projekte: So gebe es beim Bau von Arbeits- und Behördenschiffen ein enormes Potenzial für diese umweltfreundliche Antriebstechnik, da alle diese Schiffe im sensiblen küstennahen Verkehr zum Einsatz kommen.
Diesen Trend bestätigte an Bord auch Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur: Die Auftraggeber setzen bei den Ausschreibungen für Behördenschiffe nur noch auf Dual-Fuel-Motoren, die sowohl für Diesel- als auch Gasbetrieb einsetzbar sind.
Cuxhavens Oberbürgermeister Dr. Ulrich Getsch erwartet, dass künftig vermehrt Cuxhaven-Gäste das Schiff für einen Kurzurlaub zu Deutschlands einziger Hochseeinsel nutzen. Viele Ausstattungsmerkmale der neuen „Helgoland” würden ihn dabei mehr an ein Kreuzfahrtschiff als an ein herkömmliches Seebäderschiff erinnern. Eine Absage erklärt Getsch allerdings den Plänen einer möglichen LNG-Bunkerstation in Cuxhaven. Diese sieht er aufgrund von notwendigen Sicherheitsabständen und den beengten Verhältnissen im Hafengebiet eher in Brunsbüttel oder in Hamburg. Solange die neue LNG-Bunkerbarge von Bomin-Linde noch nicht in Betrieb sei, werde die wöchentliche Betankung der „Helgoland“ mit den rund 40 Kubikmetern verflüssigten Erdgases noch über eine Lkw-Betankung an der Pier in Cuxhaven erfolgen. Die Ablieferung der Barge ist nach Auskunft des technischen Direktors von Bomin-Linde, Günter Eiermann, erst für das Jahr 2017 vorgesehen. Auf Grund der logistisch schwierigen Betankung war die „Helgoland“ auf ihrer Jungfernfahrt noch mit konventionellem Dieselbetrieb unterwegs.
Brons betonte, dass nicht nur der LNG-Antrieb, sondern auch die spezielle Rumpfform zu einem umweltfreundlichen Einsatz des Schiffes beitrage. Schon in der Planungsphase wurde das ursprüngliche Rumpfkonzept, nach eingehenden Tests bei der Hamburgischen Schiffbau-Versuchsanstalt (HSVA), verändert: So ist die „Helgoland“ vier Meter länger, 20 Zentimeter breiter und mit einem Tiefgang von 3,60 Metern auch flacher als die ursprüngliche Planung geworden.
Neben einem besserem Seegangsverhalten sei auch eine höhere Energieeffizienz die Folge.
„Die Reeder bereiten sich weiter auf das Thema LNG vor“, erklärte Matthias Becker, General Manager des Motorenherstellers Wärtsilä, von dem die beiden Hauptmotoren der neuen „Helgoland“ stammen. 60 LNG-Schiffe seien derzeit schon weltweit in Betrieb, und die Motorenhersteller hätten sich auf die neue Technik eingestellt.
„Das, was wir hier an Bord der ‚Helgoland‘ haben, ist schon sehr gut“, so Becker auf die Frage, was in der Motorentechnik im Zusammenhang mit LNG noch verbessert werden könnte. CE/bo

